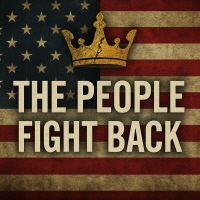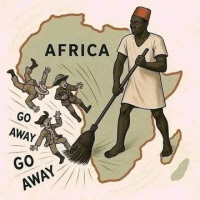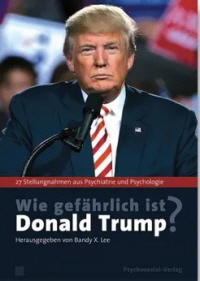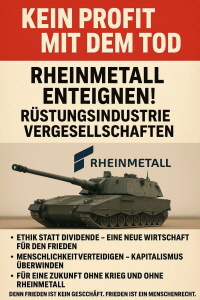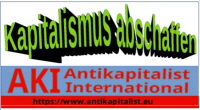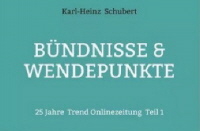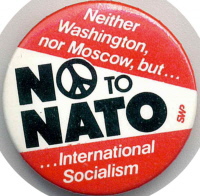im Rahmen der Umorganisation der Internetseiten entsteht hier der neue Bereich Europa. Die europäischen Nationalstaaten werden nach und nach hierher untersortiert. EU Politik und alle europäischen Länder bertreffend wird hier eingefügt.
EU-Vermögensregister:
Fakten gegen Fiktion
Immer wieder kursieren in sozialen Netzwerken und auf Videoplattformen wie YouTube Behauptungen, die EU-Kommission plane die Einführung eines zentralen Vermögensregisters für alle Bürger, Unternehmen und Institutionen. Diese Narrative werden häufig von sogenannten Vermögensverwaltern, Edelmetallhändlern oder "Krisenberatern" verbreitet, die damit Geschäfte machen und angebliche "Schutzmöglichkeiten" verkaufen wollen.
Fakt ist: Die EU-Kommission hat tatsächlich eine Machbarkeitsstudie zu einem solchen Register in Auftrag gegeben. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben wurde jedoch nicht umgesetzt und ist derzeit nicht in Planung.
Die Behauptung, Vermögen sei in Europa bislang nicht erfasst, ist zudem fundamental falsch. In Wahrheit findet eine umfassende Erfassung seit Jahrzehnten statt:
Die Finanzämter der Mitgliedsstaaten erfassen Einkommen und Vermögen systematisch über Steuererklärungen. Dies umfasst auch Immobilien, Aktien, Kryptowährungen und andere Sachwerte.
Grundbuchämter und Katasterbehörden dokumentieren lückenlos alle Grundstücke und Gebäude inklusive ihrer Belastungen.
Das Finanzwesen ist durch Meldevorschriften transparent. Banken müssen Transaktionen ab 10.000 Euro melden, und die Finanzbehörden haben Zugriff auf Kontoinformationen.
Was die Kritiker also als eine bevorstehende Neuerung darstellen, ist längst gelebte Praxis.
Das eigentliche Ziel der EU-Kommission bei der Diskussion um ein zentrales Register ist ein anderes: Es geht um effizientere administrative Abläufe und vor allem um die Durchsetzung von EU-Beschlüssen, wie etwa Sanktionen gegen Staaten oder Einzelpersonen. Ein EU-weit harmonisiertes Register könnte solche Maßnahmen beschleunigen und vereinfachen.
Kritiker sehen hier zu Recht eine Gefahr: Eine von den nationalen Regierungen beauftragte, aber nicht direkt gewählte Behörde wie die EU-Kommission könnte mit einem solchen Instrument zu viel Einfluss gewinnen. Die berechtigte Sorge ist, dass auf diese Weise die Rechtsstaatlichkeit der Mitgliedsstaaten und die Grundrechte der Bürger ausgehebelt werden könnten. Der Vorwurf lautet, dass es der Kommission unter dem Deckmantel der Verwaltungseffizienz letztlich um einen Machtzuwachs geht.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Während die Panikmache vor einem "neuen" Vermögensregister auf falschen Prämissen beruht, wirft die Diskussion darüber wichtige verfassungsrechtliche und demokratische Fragen auf. Die Debatte sollte sich weniger auf erfundene Szenarien konzentrieren, sondern vielmehr auf die legitime Frage, wie Macht und Kontrolle in der Europäischen Union verteilt sein sollen.
Und darauf wie dieses krisenhafte kapitalistische System ersetzt werden kann, um die Gesellschaft sozialer, demokratischer, friedlicher im Interesse aller Menschen zu organisieren.
Redaktion Wirtschaft, 30.9.2025
Gegen Zölle der USA:
Für Kapitalverkehrskontrollen!
Präsident Trump hat hohe Zölle gegen viele Länder angekündigt und zum Teil bereits eingeführt.
Trump begründet dies mit der nach seiner Darstellung „ungerechten" Handelsbilanz der USA, die ein hohes Defizit aufweist. Die Handelsbilanz ist jedoch nur ein Teil der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Staaten; viel umfassender ist die Zahlungsbilanz. Tatsächlich fließt ein großer Teil der Profite aus den in die USA exportierten Waren wieder zurück an die Börsen in den USA. Dies liegt daran, dass die Eigentümer der exportierenden Firmen überwiegend US-Kapitalgesellschaften sind oder große Kapitalisten, die ihr Geld in Aktien an den US-Börsen angelegt haben. Oder es handelt sich um „Vermögensverwalter" wie BlackRock in den USA, die viele Anteile an Banken und Konzernen halten.Dies führt zu einem ständigen Geldabfluss aus den genannten Ländern in die USA, was wiederum zu hohen Kapitalüberschüssen für die Reichen dort beiträgt.
Mit Kapitalverkehrskontrollen könnten diese Geldströme in die USA aufgedeckt und sogar unterbunden werden. Solche Kontrollen sind relativ einfach umzusetzen. Ein Beispiel sind die „Sanktionen" gegen Russland oder die Kapitalverkehrskontrollen, die gegen Griechenland verhängt wurden, um den Bankrott des Landes und der EU abzuwenden.
Leider sind Antikapitalisten bislang die Einzigen, die Kapitalverkehrskontrollen gegen Kapitalisten fordern, während sogenannte „Linke" den Kapitalismus lediglich retten wollen.
Das System befindet sich jedoch so oder so im Zusammenbruch. Kapitalverkehrskontrollen sind ein wichtiger Schritt, um den Kapitalismus zu überwinden.
Redaktion Wirtschaft, 3. Februar 2025
EU geht gegen Anonymität von Kryptowährungen vor:
Was die MiCA-Verordnung bedeutet
Antikapitalist Brüssel, 13.7.2025 – Das EU-Parlament hat mit der Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung (Verordnung (EU) 2023/1114) einen umfassenden Regulierungsrahmen für Kryptowährungen beschlossen. Die neuen Regelungen zielen darauf ab, Transparenz zu erhöhen und illegale Finanzströme einzudämmen – doch Kritiker sehen darin auch eine Einschränkung von Freiheitsrechten und Datenschutz.
Das ändert sich konkret
Bislang konnten Nutzer von Kryptowährungen wie Bitcoin anonym agieren: Transaktionen waren schwer nachvollziehbar, ähnlich wie einst bei Schweizer Nummernkonten – ein System, das in der Vergangenheit auch von dubiosen Akteuren genutzt wurde. Mit MiCA müssen nun Kryptobörsen, Wallet-Anbieter und Dienstleister in der EU die Identität ihrer Kunden überprüfen und diese Daten den Behörden zugänglich machen.
Auch Krypto-Geldautomaten, wie sie in Deutschland etwa von der Firma Kurant betrieben werden, fallen unter die neuen Vorschriften: Wer Bargeld einzahlt oder abhebt, muss sich künftig ausweisen. Zwar signalisieren viele Plattformen wie Bitcoin-Marktplätze und Kurant zunächst Kooperationsbereitschaft, doch Schlupflöcher bleiben – etwa bei Peer-to-Peer-Transaktionen oder bei der Nutzung besonders anonymisierter Währungen wie Monero.
Internationale Unterschiede: USA und Großbritannien setzen auf Lockerung
Während die EU reguliert, gehen andere Länder den entgegengesetzten Weg: In den USA drängen mächtige Finanzakteure wie BlackRock auf eine Deregulierung. Ein neuer Gesetzentwurf könnte der Börsenaufsicht (SEC) sogar verbieten, Kryptomärkte zu kontrollieren. Auch in Großbritannien gibt es kaum strenge Vorgaben – ein Umstand, der traditionell auch im klassischen Bankensektor gilt.
Für Anleger sind Kryptowährungen in diesen Ländern eine Fluchtmöglichkeit vor unsicheren Währungen wie dem Dollar oder Pfund. Doch auch der Euro steht unter Druck: Wirtschaftskrisen in Italien und Frankreich könnten die Währung weiter destabilisieren.
Kritik: Mehr Überwachung, weniger Freiheit?
Die MiCA-Verordnung bringt nicht nur mehr Kontrolle, sondern auch Risiken für Grundrechte: Der Datenschutz wird weiter ausgehöhlt. Politisch motivierte Sanktionen könnten leichter verhängt werden – etwa gegen Kritiker der Regierungspolitik.
Die Umsetzung in allen EU-Ländern ist ungewiss, besonders in wirtschaftlichen Krisenzeiten.
Zudem bleibt fraglich, ob die Regulierung tatsächlich wirkt: Solange Länder wie die USA oder Großbritannien freiere Märkte zulassen, können Nutzer auf ausländische Plattformen ausweichen.
Kryptowährungen – ein Symptom des kriselnden Kapitalismus
Kryptowährungen sind kein Ausbruch aus dem Finanzsystem, sondern ein Spiegelbild seiner Probleme: Sie dienen als Spekulationsobjekt und Absicherung gegen Währungsverfall. Doch was wirklich fehlt, ist eine Wirtschaft, die Bedürfnisse der Menschen vor Profite stellt – statt einem System, das auf endloses Wachstum und Kapitalrendite getrimmt ist.
Die MiCA-Verordnung ist ein erster Schritt zur Kontrolle – doch ob sie langfristig Erfolg hat, hängt von politischen und globalen Machtverschiebungen und der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems ab.
Weitere Artikel im Bereich Wirtschaft
Europäische Zentralbank übernimmt:
Die Abschaffung der Privatbanken kommt!
Banken sind im Kapitalismus systemrelevant – daran besteht kein Zweifel. Die Kapitalisten treibt daher die tiefe Sorge um, dass es mit dem sogenannten "Wachstum" vorbei sein könnte. Nicht nur können keine neuen Schuldenblasen mehr gebildet werden, sondern der gesamte Schuldenblasenschaumteppich des Systems droht zu zerplatzen und das System in einem großen Kladderadatsch scheitern zu lassen.Bereits während der globalen Finanzkrise 2007/2008 übernahmen Staaten weltweit zahlreiche Konzerne und Banken oder "retteten" sie durch teure staatliche Kredite und administrative Maßnahmen wie das Einfrieren von Börsen und Kursen. Internationale Institutionen wie die EZB, der IWF und die Weltbank verhinderten mit Kapitalverkehrskontrollen den finanziellen Zusammenbruch ganzer Staaten wie Griechenland, Zypern und Island.
Solche Maßnahmen ergreifen die Kapitalisten nur widerwillig durch ihre Staaten, da sie ihre sektiererischen Predigten widerlegen, wonach der Markt angeblich alles regle und es dann allen gut gehe. Doch diese Maßnahmen sind lediglich ein Aufschub, eine Verlangsamung des Zusammenbruchs, in dem sich das kapitalistische System bereits befindet: Große Staaten sind immer höher verschuldet, und immer mehr Banken – wie die Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS oder deutsche Volksbanken – müssen fusionieren oder Hilfen in Anspruch nehmen.
Den Kapitalisten ist klar, dass die Privatbanken die nächste Verschärfung der Krise nicht mehr überstehen könnten. Die Überschuldung und der erhöhte Geldumlauf haben die Inflation bereits stark angeheizt, sodass größere "Rettungsmaßnahmen" nicht mehr möglich sind. Zudem droht die Eskalation des Handelskriegs mit den USA, was Konzerne, Börsen und Banken erzittern lässt.
Gleichzeitig sind die Banken durch die vergangene Entwicklung bereits schwer angeschlagen. Sie müssen Auflagen staatlicher Regulierungsbehörden erfüllen und verfügen für Kreditvergaben über keine eigenen Mittel mehr, sondern nur noch über Gelder der EZB, die diese durch Geldmengenausweitung generiert. Zudem fließt Kapital zunehmend in Schattenbanken, Vermögensverwalter, Kryptowährungen und andere Nischen.
Faktisch haben Privatbanken bereits viel von ihrer Selbständigkeit verloren. Bei verschärfter Krise ist ihre Angliederung an die EZB gewiss. Pläne, die in Hochfinanzkreisen bereits offen diskutiert werden, sehen vor, dass Banken zu einem Teil der EZB werden und für diese Geschäfte abwickeln.
Je nach Krisentiefe steht mit dem "Digitalen Euro" auch eine Währungsreform bereit: Bargeld würde abgeschafft und Giralgeld in digitale Euro umgerechnet. Dieses Szenario bedroht vor allem große Geldvermögen, da die Rechnung irgendwo aufgehen muss und nur dort relevante Summen zu holen sind. Die Flucht aus Euro und Dollar hat bereits begonnen, während Kapitalisten weltweit nach Auswegen suchen, die durch Kapitalverkehrskontrollen unterbunden werden könnten.
Diese grob skizzierte Entwicklung ist bereits erzwungenermaßen im Gange. Doch wie reagieren politische Strömungen und Antikapitalisten?
Antikapitalisten haben diese Entwicklung lange vorhergesehen, da der Kapitalismus wie ein Kettenbrief funktioniert und zwangsläufig an sein logisches Ende gelangen muss. Kapitalisten können und wollen das Ende des Kapitalismus mit den genannten Maßnahmen nur verzögern – sie sind gewissermaßen alternativlos, was sie ungern einsehen. Antikapitalisten treiben durch Aufklärung die Entwicklung voran und wollen sie im Interesse der Mehrheit sozial gerecht, demokratisch und unter Erhalt von Umwelt und Klima gestalten. Dazu gehören:
Ein bedingungsloses gutes Einkommen für alle
Begrenzung von Vermögen und Einkommen der Reichen
Wirksame Kapitalverkehrskontrollen
Regulierung des Großkapitals
Abschaffung der Privilegien von Politikern und Parteien zugunsten demokratischer und imperativer Mandate
Die Kapitalisten sind also durch die Systemkrise gezwungen, teilweise antikapitalistische Maßnahmen zu ergreifen. Leider sind Linke außerhalb der Antikapitalisten sehr konservativ: Sie sind gegen die Abschaffung von Bargeld und Geld allgemein, gegen bedingungslose Einkommen und für kapitalistische Lohnarbeit. Sie setzen sich ein für die "Rettung" von Banken und Konzernen, für die Interessen von "Kleinsparern" mit über 100.000 Euro und für den Weiterbetrieb der Banken unter Verstaatlichung – Maßnahmen, die die Kapitalisten in ihrer Not längst versucht haben.
Doch solche Politik hat keine Zukunft. Links muss antikapitalistisch sein – oder sie ist nicht links.
Redaktion Wirtschaft, 28. M
ärz 2025 Print
Print
 RSS
RSS